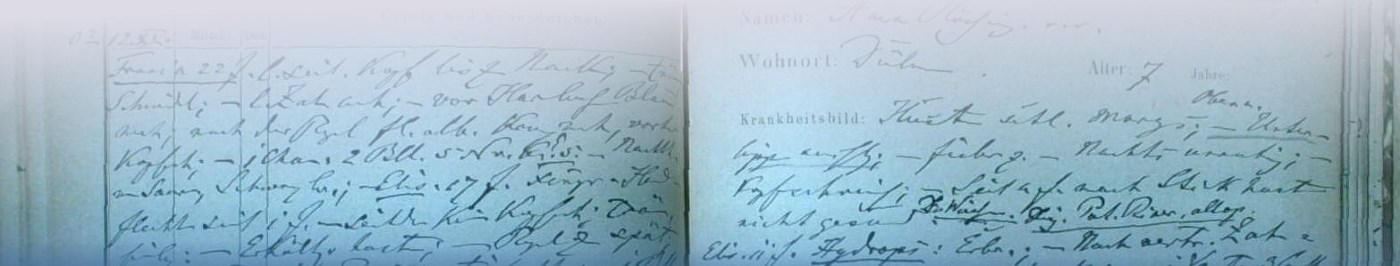Zur Herstellung homöopathischer Q-Potenzen
(Artikel, erschienen in der Homöopathie-Zeitschrift. Alle Rechte beim Autor)
Wenn wir heute ein homöopathisches Arzneimittel verschreiben oder kaufen, so scheint es selbstverständlich, dass dieses in D-, C- oder Q- bzw. LM-Potenzen verschiedener Höhen erhältlich ist. Kenner haben vielleicht noch die eine oder andere Spezialadresse für besonders hergestellte Potenzen, dennoch bleibt es bei dieser grundlegenden Klassifizierung. Die Konfektionierung als Tropfen, Globuli oder meist zu Tabletten gepresster Triturationen spielt dem gegenüber nur eine untergeordnete Rolle. Verfolgen wir den Weg Hahnemanns zu den heute so bezeichneten homöopathischen Q-Potenzen, so sieht es etwas anders aus: die Arzneiherstellung war ein in ständiger Entwicklung befindlicher Prozess und wir finden eine Reihe von Variationen des Potenzierungsverfahren bei Hahnemann. Allein die Angaben zur Verschüttelung reichen von zwei bis zu zweihundert Schlägen oder ‘minutenlangem’ Schütteln, ebenso schwanken Globuligröße, Konzentration des verwendeten Weingeistes und die Bevorzugung eines flüssigen oder festen Mediums. Meine Absicht hier ist kein historischer Abriss dazu, sondern die Beweggründe denkend nachzuvollziehen und vor diesem Hintergrund die Herstellung analog der sechsten Organonausgabe als grundlegender Veröffentlichung zu diesem Thema zu beschreiben.
Sinn der Q-Potenzen
Im Organon, Paragraph 2 wird das Idealziel der Heilung beschrieben: sanft und rasch soll sie vonstatten gehen, neben weiteren Kriterien wie Nachhaltigkeit und Nachvollziehbarkeit der Gesetzmäßigkeiten. Sanft und doch rasch: für das übliche medizinische Verständnis eine diametrale, gegensätzliche Forderung. Entweder Radikalkur mit Medikamenten, die heute im allgemeinen verschreibungspflichtig sind, oder eben Hausmittelchen und Blümchentee – dann darf’s bitte auch ein wenig länger gehen. Nimmt die Homöopathie nun in Anspruch, beides zugleich zu können? Blitzschnell und ohne Nebenwirkung? Wenn wir ein etwas anspruchsvolleres Verständnis von Heilung haben, werden wir, besonders bei chronischen Prozessen, den Faktor Zeit freilich nicht ausschalten können. Die Lebenskraft selber, vielleicht die grundsätzliche Heilungsbereitschaft des Patienten gibt einen gewissen Rahmen vor. Innerhalb dieser Grenzen lässt sich die Anwendung dennoch optimieren, durch die bestmögliche Art der Verabreichung einer auf geeignete Weise hergestellten Arznei. Grundvoraussetzung ist freilich, vor jeder Diskussion über Potenzen, ein gut gewähltes Mittel.
Im sechsten Organon, § 246 finden wir das Spannungsfeld beschrieben zwischen der Notwendigkeit des ‘Auswirken-Lassens’ eines gegeben Mittels und den Vorteilen für eine (sanfte und) raschere Heilung, wenn sich das Mittel unter Umständen doch häufiger wiederholen ließe. Die wichtigste Voraussetzungen für häufige Gaben: kontinuierliche Modifikation von Gabe und Potenz sowie weitere Reduzierung der Gabengröße zum ‘kleinstmöglichen’ hin. Nebeneffekt: unbeabsichtigte Arzneisymptome, sei es als Erstreaktion oder durch ein nur teilweise passendes Mittel, klingen dann nach Absetzen des Mittels rasch wieder ab. Mit der geforderten maximalen Verkleinerung der Gabe kommen wir schon zum eigentlichen Clou der Q-Potenzen: die Gabenverkleinerung ist in deren Herstellungsprozess nämlich teilweise schon integriert.
Gabenverkleinerung inklusive
Bevor wir die Herstellung im Detail beschreiben, wird es sich lohnen, den Begriff der „Gabe“ bei Hahnemann etwas näher anzuschauen. Vor der Veröffentlichung des 6. Organon identifizierte die homöopathische Fachwelt den Begriff Gabe meistens mit der Potenzhöhe – demnach wären die von Hahnemann oftmals geforderten kleinstmöglichen Gaben den höchsten Potenzen gleichzusetzen. Demgegenüber steht die (richtigere) Auffassung, mit Gabe sei schlicht die Dosierung gemeint – freilich nicht allein in quantitativem Sinne, sondern als Intensität des Austausches zwischen Arznei und aufnahmefähigen Körperoberflächen. Darum wird auch die trockene Gabe eines mohnsamen Kügelchen als eine der kleinsten Gaben bezeichnet (vgl. Organon § 272).
Mein Eindruck ist, dass sich Hahnemanns Gabenbegriff sowohl auf die Dosierung im Sinne der Intensität des Kontaktes mit einer Arznei wie auf die Potenzierung bezieht. Auf letztere allerdings nur teilweise. Denn Potenzierung ist bekanntlich eine Verbindung zweier Vorgänge: der ‘Dynamisierung’ durch Reiben oder Schütteln und einem vorausgehenden Verdünnungsprozess. Praktisch gesehen macht es wenig Sinn, von der Potenzierung an und für sich schon als Gabenverringerung zu sprechen, da die Verdünnung zugleich Raum schafft für eine nachfolgende Intensivierung, nicht Abschwächung der für uns relevanten Arzneieigenschaften. Doch lässt sich ja auch das Verhältnis von Dynamisierung und Verdünnung zueinander ändern, das eine oder andere mehr oder weniger betonen. In der Veränderung dieser Relation zeigt sich die stärkere Betonung der Verdünnung als durchaus mögliches Instrument zur Gabenverringerung, was eine entsprechende Modifikation der arzneilichen Eigenschaften der potenzierten Substanz erwarten lässt.
Wird etwa je Potenzierungsschritt bei normaler Verdünnung nur zweimal geschüttelt (vgl. Hahnemann, RAL, Angaben für Drosera als C-Potenz), so so ist die Dynamisierung vergleichsweise sanfter als bei zehn oder gar hundert Schlägen. Für die Q-Potenzen ging Hahnemann den umgekehrten Weg wie bei der ‘heroischen’ Pflanze Drosera: nicht die Schüttelschläge wurden reduziert, sondern die Verdünnung wesentlich gesteigert – mit dem gleichen Ziel einer Gabenverringerung. Zwar wurde auch die Zahl der Schüttelschläge erhöht (von zehn auf hundert), doch weitaus stärker wurde die Verdünnung heraufgesetzt (von 1:100 auf 1:50.000 je Potenzierungsschritt).
Erstmal gründlich reiben
Freilich sind unsere Q-Potenzen (zumal gut hergestellte) trotz dieser ‘integrierten Gabenverkleinerung’ recht kräftig und nicht zu unterschätzen. Ich würde aus eigener Erfahrung empfehlen, die Dosierung stärker zu reduzieren und seltener zu wiederholen, als man nach Lektüre des Organon denken mag (zweimal wöchentlich kann durchaus genug sein, bei chronischen Erkrankungen). Schon mit den ‘untersten Graden’ (Anmerkung zu Org. § 246) erleben wir Feinheiten der Arzneiwirkung, die sonst eher den höheren C-Potenzen zugeschrieben werden. Das wird mit daran liegen, dass der stärkeren Verdünnung zunächst ein sehr gründlicher, mehrstündiger Verreibeprozess vorausgeht: Ausgangsstoff für die Q-Potenzen ist, wann immer möglich, die ‘C3-Verreibung’.
Die vergleichsweise arbeitsaufwendige Verreibung bis zur dritten Centesimalstufe erwies sich bereits zu Anfangszeiten der Homöopathie als chemisch-physikalische Notwendigkeit, soweit man im Wasser-Alkohol-Gemisch unlösliche Substanzen potenzierten wollte: ab einer millionenfachen Verdünnung und feinster Verteilung werden selbst Metalle oder Öle ‘löslich’, indem die Teilchen durch die thermische Molekularbewegung in Schwebe gehalten werden. ‘Kolloidale Lösung’ nennt der Chemiker das heute. Zunächst einmal galt: Verrieben werden nur unlösliche Stoffe bis zur C3, um danach flüssig weiter potenziert zu werden. Ansonsten wurde von Beginn an flüssig potenziert.
Später finden wir die umgekehrte Priorität: Hahnemann fordert Verreibung bis zur C3, wann immer zu realisieren – also ausgenommen für Stoffe wie z.B. starke Säuren (oder Glonoinum…), die durch ihre Reaktivität gewisse Schwierigkeiten bereiten würden. Selbst für Phosphorus beschreibt Hahneman ein geringfügig modifiziertes Verfahren, mit dem eine Verreibung möglich wird.
Bei Lektüre von Hahnemanns ‘Chronische Krankheiten’ (Bd. 1, Abschnitt ‘die Arzneien’; auch Vorwort zu Schwefel… ) wird deutlich, dass sich die Priorität des Verreibens bis zur C3 keineswegs nur auf Q-Potenzen bezieht, wie einzelne Autoren glauben machen. Eine Änderung des HAB (Homöopathisches Arzneibuch 1978) ist in dieser (und anderer) Hinsicht längst überfällig. Ein echter Rückschlag für die Homöopathie, wenn die Angaben des HAB (noch schlimmer: EUAB…) jetzt auch noch zur gesetzlichen Grundlage der Arzneiherstellung erhoben werden sollen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hahnemann durch intensive Verreibung bis zur C3 und (last, but not least!) optimale Rohstoffqualität (siehe Org. §§ 266, 267) eine Qualitätssteigerung erreichte, die bei der weiteren Potenzierung ein vormals nicht übliches Verdünnungsverhältnis erlaubte, ohne Wirkung und Zuverlässigkeit der Arznei zu gefährden.
Die C3, genau
Für die C1-Verreibung wird 0,06 Gramm der Ausgangssubstanz mit 6 Gramm Milchzucker in einem Porzellanmörser vermischt und eine Stunde lang verrieben. 0,06 Gramm der damit erhaltenen C1 wird in gleicher Weise zur C2 weiter verarbeitet und davon wiederum sechs hundertstel Gramm unter Beifügung von Milchzucker zur C3. Soweit die Kurzbeschreibung.
Die genaue Anleitung finden wir im Organon, Anmerkung zu § 270. Das Apothekergewicht ‘Gran’ hat nichts mit Gramm zu tun, sondern entspricht dem Gewicht eines durchschnittlichen Tropfen Wassers, mithin sechs hunderstel Gramm. Mehr benötigen wir nicht, um Medizin für eine ganze Stadt herzustellen! Diese kleine Menge wird zunächst nur mit einem Drittel des Milchzuckers, mithin 30 Gran oder 2 Gramm, vermischt und dann 6 bis 7 Minuten mit einem Pistill in einer Mörserschale verrieben. Danach werden am Rande der Mörserschale oder dem Pistill anhaftende Reste des Pulvers mit einem Porzellanspatel gründlich losgescharrt und untergemischt, 3 bis 4 Minuten lang. Dann wird das zweite Drittel des Milchzuckers untergemischt und wiederum 6 bis 7 Minuten gerieben und 3 bis 4 Minuten gescharrt. Ebenso mit dem letzten Drittel des Milchzuckers, bis nach einer Stunde fleißigen Reibens und Scharrens die C1 bzw. nach gut drei Stunden (zuzüglich Abwiegen und wunde Finger pusten…) die C3 fertiggestellt ist.
Aus unserer Erfahrung empfehlen wir für eigene Versuche Porzellanmörser mit ca. 9 bis 10cm Innendurchmesser. Hahnemann zufolge sollten Mörserschale, Pistill und Spatel glasiert und an den mit der Verreibung in Berührung kommenden Flächen mattgerieben sein; auf der Innenseite bzw. am unteren Ende unglasierte Werkzeuge sind heute üblicher und m.E. bei hochgebranntem Laborporzellan genauso geeignet.
Einige Kollegen sprechen Arzneien, die bis zur vierten Centesimale verrieben wurden, noch feinere Wirkungen auf höherer Ebene zu. (Auf die Inauguration der ganz neuartigen C7-Homöopathie verzichtete unser Arbeitskreis ja vorläufig, nachdem schon die C3-Herstellung mit Blasen an einigen unserer ungeübten Hände endete…)
Und weiter geht’s: die Q-Stufen
Die C3-Verreibung liefert ja nur das ‘Rohmaterial’ für das, was den Q-Potenzen (Quinquagintamillesimal-Potenzen) den Namen gibt: Die Verdünnung im Verhältnis 1:50.000 je weiterem, nun folgenden Potenzierungsschritt. Genaugenommen ist es jeweils ein Doppelschritt: zuerst wird im Flüssigen 1:99 (HAB) bzw. 1:100 (Hahnemann) verdünnt, dann folgen 100 Schüttelschläge (nicht 10 wie üblicherweise bei den C-Potenzen), mit der so potenzierten Lösung werden mohnsamengroße Globuli dann befeuchtet, wodurch eine nochmalige Verdünnung von 1:500 resultiert. Das Endresultat jeder weiteren Q-Potenzierung sind daher immer Kügelchen, die vor dem Abfüllen nur noch trocknen müssen. Wenn wir eine Q-Potenz als Dilution kaufen, so wurde in einem 10ml-Fläschchen nur ein Globulus in Wasser / Alkohol aufgelöst (zur Konservierung reichen 20% Äthanol vollauf). Darum sind Globuli guter Hersteller unter Insidern recht begehrt: liefern sie doch einen schier unerschöpflichen Arzneivorrat.
Freilich gibt es da noch einige Details, die zu beachten wären. Beispielsweise würde der sonst zu Potenzierungszwecken verwendete 45%ige Alkohol die Streukügelchen (Saccharose, nach Hahnemann aus Rohrzucker) nicht nur befeuchten, sondern hoffnungslos verkleben, da er sie zu stark anlöst. 85 Prozent Alkohol sind nötig, damit die Oberfläche der Globuli ohne Verklebung gut benetzt wird. Überschüssige Lösung muss rasch ablaufen können – durch untergelegtes Fließpapier (Hahnemann) oder ein Behältnis mit feinen Löchern im Boden. Ob das verwendete Verfahren eine Benetzung aller Kügelchen gewährleistet, lässt sich heute im Experiment mit dem Farbstoff Methylenblau recht gut nachprüfen. Immerhin wäre ein einziges ‘taubes’ Kügelchen in der Lage, alle im Weiteren daraus hergestellten Q-Potenzen wertlos zu machen.
Die notwendigerweise hohe Alkoholkonzentration führt dazu, dass das zur Anfertigung der nächsthöheren Q-Potenz verwendete Globulus der vorangegangenen Potenz erst mit einigen Tropfen Wasser angelöst werden muss. Sonst würde das Kügelchen ungelöst am Boden des Glaskolbens liegen bleiben.
Schon zum Stolperstein wurde die Frage, wie die gewünschte Verdünnung von 1:500 erzielt wird. Maßgeblich ist hier die Adsorptionsfähigkeit, insbesondere die Größe der Oberfläche der Globuli im Verhältnis zu ihrem Gewicht, was sich aus deren Durchmesser ergibt. Geeignet scheinen mohnsamengroße Kügelchen à 0,0006 Gramm – erst ca. 1600 solcher Globuli wiegen ein Gramm, nicht schon 470 – 530 Globuli der im HAB genannten ‘Größe 1’. Nach einer Untersuchung von Andreas Grimm (KH…) resultiert bei einem Vorgehen laut HAB eine Verdünnung von nur ca. 1:220; zusammen mit der vorausgehenden flüssigen Potenzierung erhalten wir damit nur etwa 22.000er und keine 50.000er Potenzen. Gewissermaßen inoffiziell hat es sich unter vielen Kollegen eingebürgert, rundum korrekt hergestellte Mittel als Q-Potenzen und andere als LM-Potenzen zu bezeichnen. Maßgeblicher als das exakte Verdünnungsverhältnis dürfte die Qualität der Ausgangssubstanz sein. Bei Pflanzen beispielsweise: Zeitspanne zwischen Ernte und Verreibung (also Frische), Pflanze von natürlichem Standort oder aus Kultur; bei allen Stoffen: Nachvollziehbarkeit der Quelle (ein Problem bei Petroleum, Sanicula aqua, Carcinosinum und vielen anderen Stoffen). Das Vorgehen bei der C3-Verreibung spielt ebenso eine Rolle; nicht zu vergessen jedoch: der Hauptfaktor für das eingangs zitierte Ziel einer raschen und sanften Heilung ist immer der Ähnlichkeitsgrad der verschriebenen Arznei.
In letzter Konsequenz wird auch der Patient bei sachgemäßer Applikation von Q/LM-Potenzen zum Mit-Hersteller, indem er sich eine flüssige Q-Potenz (hergestellt aus einem Globulus in ca. 10ml Wasser-Alkohol-Gemisch, unverschüttelt) vor jeder Einnahme mit ca. 7 bis 10 (oder 12) Schüttelschlägen auf den Handballen nachpotenziert. Hat das Fläschlein dann nach ca. 10 Einnahmen ca. 90 – 100 Schüttelschläge erhalten, so läßt sich im Sinne einer ‘gleitenden’ Erhöhung der Potenzierung nun idealerweise die nächsthöhere Q-Potenz anschließen, die ja schon ‘von Haus aus’ 100 Schüttelschläge mehr hat (vgl. 6. Org. §§ 161 und 246ff.).
Vor längeren Reisen sollte eine Q-Potenz luftraumfrei gemacht werden, indem das Fläschlein nach Entfernung des Tropfers mit 20- bis 40%igem Alkohol randvoll aufgefüllt wird und nach Ankunft wieder etwas Flüssigkeit abgegossen, so dass ca. 1/3 des Flaschenvolumens wieder als Schüttelraum zur Verfügung steht (ca. 20% Alkohol sind das Minimum, damit handelsübliche Tropfer noch funktionieren). Das Gleiche nach Rückkunft. Die Dosierung kann dieser Nachverdünnung entsprechend angepasst werden. Gleichwohl spielt die individuell sehr unterschiedliche Empfänglichkeit gegenüber der Arzneiwirkung (Org. § 281) und die damit verbundene Notwendigkeit eines guten Kontaktes mit dem Patienten zwecks individueller Dosisanpassung eine größere Rolle als Erbsenzählen.
Zweifler stellen gelegentlich die Frage, ob der bei dem beschriebenem Verfahren verwendete Milchzucker (der C3-Verreibung) und Rohrzucker (der Globuli) nicht mit potenziert wird. Tatsächlich ist dies theoretisch wohl kaum auszuschließen. Die Erfahrung weist eher darauf, dass die am Anfang des Prozesses stehende potenzierte Substanz dem als Arzneiträger verwendeten Stoff ihren Stempel aufprägt und gegenüber sekundär eingebrachten Stoffen die Oberhand behält: auch bei mittleren und höheren D- und C-Potenzen hätten wir sonst Probleme dadurch, dass selbst bei größter Sorgfalt Verunreinigungen die Ausgangssubstanz bald überwiegen würden. Abgesehen davon, dass wir nach heutigem Stand weder bei Alkohol noch bei Wasser voraussetzen können, dass diese unarzneilich seien.
Carl Classen, 1999
Literatur:
- Samuel Hahnemann, 6. Organon (textkritische Ausgabe), Haug Verlag
- Samuel Hahnemann, Chronische Krankheiten, Haug Verlag
- Samuel Hahnemann, Reine Arzneimittellehre, Haug Verlag
- Homöopathisches Arzneibuch 1978, Dtsch. Apotheker-Verein
- Peter Bartel, Das Vermächtnis Hahnemanns, KH 1993/3
- Werner Dingler (Seminaraufzeichnungen)
- Carl Classen, Q-Potenzen – Studienblätter (auch Sonderdruck Q-Potenzen)